Liebe Leserinnen und Leser,
das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist nach monatelangem Gezerre auf dem Weg. Ist das gut? Ja – denn der Einstieg in die Wärmewende ist drängender denn je. Die überarbeitete Fassung ist nun gekoppelt an Erhebungen und Versorgungskonzepte auf kommunaler Ebene. Ist das gut? Selbstverständlich – denn bei allen Gesetzen, Verordnungen und technischen Regelungen der letzten Jahre und Monate, diesem Kleinklein der Klimaschutzpolitik, ist es sinnvoll, eine ganzheitliche Perspektive zu haben die Menschen „mitzunehmen“. Also am Ende doch noch alles gut? Leider nein.
Ein Ende der fossilen Heizungen muss her, das ist klar – und im Koalitionsvertrag auch fixiert (damals noch für Anfang 2025). Doch auch wenn der Handlungsdruck noch so groß ist, muss politisches Tun für die Betroffenen transparent und nachvollziehbar sein. Es reicht nicht aus, auf die Versäumnisse früherer Bundesregierungen hinzuweisen. Gerade wenn es um Entscheidungen geht, die erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf das Gros der Bevölkerung haben, müssen Gesetzentwürfe gut (also gerecht) sowie klar gestaltet und gut kommuniziert werden. Die Debatte um das GEG war in dieser Hinsicht ein Gegenbeispiel – und bildet nun eine Hypothek für weitere Anstrengungen im Klimaschutz.
Der jetzt geschlossene Kompromiss sieht nun nicht nur (zu) viele Ausnahmen und Optionen vor: Die Verkettung mit der kommunalen Wärmeplanung wiederholt altbekannte Fehler. Denn es entsteht eine Allianz der neuen Regelungen im GEG (insb. der 65-%-Quote) mit einem noch nicht ausformulierten, geschweige denn politisch beschlossenen Planungsgesetz für die Wärmeversorgung von Morgen. Nur ein Beispiel: Kommt ein Anschlusszwang für Wohnquartiere, in denen die Kommune Nahwärme präferiert? Erneut gibt es offene Fragen, erneut potenzielle Hürden. Es liegen kaum Erfahrungen mit dem neuen Instrument vor, es ist nicht klar, welche rechtlichen Ansprüche an eine kommunale Wärmeplanung gestellt werden. Es ist noch nicht definiert, wie verbindlich damit der Ausbau von regenerativen Wärmenetzen vorangebracht wird und wie Transformationsprozesse für die Umstellung von Erd- auf „regeneratives“ Gas aussehen sollen. Zwar gehören die Themen zusammen, soll den Bauherren aufgezeigt werden, welche Wärmelösung am Standort ihres Gebäudes zu erwarten ist, jedoch wird gleichzeitig eine Kohärenz aufgebaut. Kurzum: Das neue GEG beantwortet Fragen – und wirft neue auf. Und das heißt: Die nächste Debatte kommt bestimmt. |
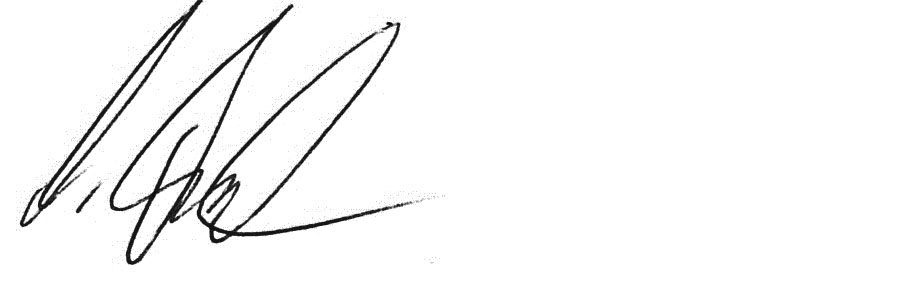 |
Manfred Rauschen
Geschäftsführender Gesellschafter |
|
Warten auf die technische Feenstaub-Revolution: Das „neue“ GEG schiebt den Heizungswechsel nach hinten
|
|
|
|
Ein Referent der jüngsten „Kommunen-Tagung“ brachte es auf den Punkt: „Ob Sie auf Wasserstoff warten wollen oder auf Feenstaub – beides ist gleichermaßen realistisch“. Gelächter im Publikum. Die Politik sieht das anders: Für welchen der beiden innovativen Energieträger sich die deutschen Heizungsbesitzer in Zukunft entscheiden wollen – der neue Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz lässt ihnen die Wahl. Der ausgehandelte Kompromiss ist so „technologieoffen“ und voller Ausnahmen, dass sich zwar das Inkrafttreten zum 1. Januar umsetzen lassen dürfte, die eigentlich mit dem GEG verfolgten Ziele jedoch nach hinten rücken. Allerdings: Ist nicht ein Gesetz, das bald in Kraft tritt, besser als eines, das in Schublade liegen bleibt?
Eine schwierige Frage – auf die es keine einfache Antwort gibt. Politik sei immer „die Kunst des Möglichen“, soll Bismarck gesagt haben. Das, was in Berlin derzeit „möglich“ ist, haben wir in unserem Überblicksartikel zum „Heizungsgesetz“, wie das GEG inzwischen im Volksmund heißt, ergänzt. Die 65-%-Pflichtanteil bezüglich des Einsatzes Erneuerbarer Energien bleibt im Kern bestehen, wird aber mit der kommunalen Wärmeplanung verkoppelt – und eine solche liegt in den seltensten Fällen schon vor. Gasheizungen, die (hoffentlich) auf Wasserstoff umrüstbar sind, dürfen weiterhin eingebaut werden. Das Verbrennen von Holz, kritisiert als Feinstaubquelle und aus ökologischen Gründen, gilt als „erneuerbare“ Energie. Und: Alter schützt vor Torheit nicht – mit 80 oder mehr Jahren darf man seine Dreckschleuder weiter betreiben. Das alles macht das „neue“ GEG so löchrig wie einen Schweizer Käse. |
Öl und Gas raus, Erneuerbare und Ganzheitlichkeit rein: Gesetz für die Wärmeplanung geht auf dem Weg durch die Instanzen
|
|
|
|
Jeder Mensch braucht Wärme. Für dieses Grundbedürfnis werden allein in Hamm, einer Ruhrgebietsstadt mit 180.000 Einwohnern, jedes Jahr schätzungsweise 540.000 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Dieser Wert muss runter, das ist klar. In Hamm soll dabei ein „Fokuskonzept Wärme“ helfen: Stadt und Stadtwerke haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das den Bestand erfasst und alternative Wärmeversorgungsarten aufzeigt. Damit ist die Stadt Vorreiter bei einem Trend, der ohnehin auf die deutschen Kommunen zurollt: Das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (WPG) verlangt von ihnen die Erstellung von Wärmeplänen. Seit Anfang Juni liegt ein Entwurf für das WPG vor – dessen ohnehin große Bedeutung durch die Verknüpfung mit dem GEG noch einmal gewachsen ist.
Was Hamm (mithilfe des Öko-Zentrums NRW) schon angepackt hat, sollen Kommunen ab 10.000 Einwohner bis Ende 2027 abliefern. Für Städte mit mehr als 100.000 Wärmesuchende endet die Frist schon zwei Jahre früher. Nur sehr kleine Kommunen sind – noch – ausgenommen; für sie soll es Regelungen auf Länderebene oder ein vereinfachtes Verfahren geben. Damit nicht genug: Alle fünf Jahre ist eine Fortschreibung der Wärmeplanung vorgesehen. Und: Das Gesetz nimmt nicht nur die Wärme-Zukunft in den Fokus, sondern bereits die Gegenwart: Bestehende Wärmenetze sind schrittweise zu dekarbonisieren, für neue gilt – wie im privaten Heizungskeller – eine 65-%-EE-Mindestquote. Im Juli soll der WPG-Entwurf – den wir hier vorstellen - vom Bundeskabinett beschlossen werden und danach ins parlamentarische Verfahren gehen. |
Höchste Eisenbahn bei der Förderung von Energieberatungen für Wohngebäude: Neue Richtlinie soll schon ab Juli gelten
|
|
|
|
Auf die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn ist Verlass – jedenfalls beim Fahrplanwechsel. Dieser kommt mit schöner Regelmäßigkeit zweimal im Jahr und lässt sich anders als das Eintreffen der Züge lange im Voraus berechnen, bis mindestens 2059. Eine solchen Vorlauf gab es bei einem anderen „Fahrplanwechsel“, der ebenfalls im Juni stattfand, nicht: Mit nur knapp zwei Wochen Frist kündigte das BAFA via Pressemitteilung an, dass schon zum 1. Juli 2023 eine neue Richtlinie für die Bundesförderung der Energieberatung für Wohngebäude (EBW) in Kraft treten soll. Eine zentrale Änderung darin: Die Möglichkeit, für Wohngebäude einen „klassischen Beratungsbericht“ einzureichen, fällt weg. Bei allen geförderten Energieberatungen muss künftig ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellt werden.
Die Umstellung wird von Branchenakteuren teils kritisch gesehen. Die Anwendung des iSFP könne für Gebäudebewertungen eine Einschränkung darstellen, so die Befürchtung. Beispielsweise könne auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen verzichtet werden und auch Gegenüberstellungen verschiedener Sanierungsvarianten seien sind nicht mehr ohne Weiteres möglich (beziehungsweise nur mit einem zweiten iSFP). Die Energieberatung bleibe dadurch hinter ihren Möglichkeiten zurück. Auch eine andere Neuerung stößt auf ein gemischtes Echo: Die Zuschüsse sollen in Zukunft an die Beratungsempfänger/innen ausgezahlt werden, die dann auch den Förderantrag selbst stellen und abwickeln müssen. Bislang lief das alles über die/den Energieberater/in, sodass Beratungssuchende kaum Berührungspunkte mit den Förderregularien hatten und lediglich den Eigenanteil bei einer Förderquote von 80 Prozent zu zahlen hatten. Allerdings mussten Energieberater/innen teils sechs Monate auf die Auszahlung der Mittel warten, weshalb hohe Ausstände entstanden und die Umstellung gefordert wurde. Dennoch könnte letztere die Abläufe verkomplizieren und einige Kunden von der Inanspruchnahme der Förderung abschrecken, da nun zunächst das volle Beratungshonorar bezahlt werden muss. Was sonst noch neu ist bei der kommenden EBW-Richtlinie, haben wir hier für Sie zusammengefasst. |
Bis zu 240.000 Euro: Zinsgünstige Kredite sollen Familien zu klimafreundlichem Wohnraum verhelfen
|
|
|
|
Rund 1,6 Kinder je Frau – das ist laut Statistischem Bundesamt die aktuelle Geburtsziffer. Nur bei jeder zwanzigsten Frau zählten die Mathematiker der Behörde vier oder mehr Sprösslinge. Solche Angaben sind nicht nur relevant für Prognosen zum demografischen Wandel – sie stecken auch den Rahmen ab für einen neuen Fördertopf, der das Programm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN) ergänzt und seit dem 1. Juni nutzbar ist: Die Neubauförderung "Wohneigentum für Familien“ (WEF) des Bundesbauministeriums unterstützt Familien mit Kindern und geringem oder mittlerem Einkommen beim Bau oder Ersterwerb von Wohneigentum. Dies erfolgt in Form von zinsgünstigen KfW-Krediten – für die die Kinderzahl ein zentrales Kriterium darstellt.
Um für eine Förderung in Frage zu kommen, müssen die Vorhaben mehrere Voraussetzungen erfüllen: Unabdingbar ist, dass sie klimafreundlich sind; dabei gelten die technischen Anforderungen des regulären KFN-Förderprogramms. Des Weiteren darf bisher kein Wohneigentum vorhanden sein und das künftige ist selbst zu nutzen. Zudem muss mindestens ein Kind im Haushalt leben. Der maximale Kreditbetrag richtet sich nach der Förderstufe und der Zahl der Kinder. Bei einem oder zwei beträgt der Kredit bis zu 140.000 Euro, bei einem klimafreundlichen Gebäude mit QNG-Bonus sowie fünf Kindern kann er bis auf 240.000 Euro steigen. Nähere Infos lesen Sie in unserem KFN-Artikel, den wir um die neue Familienförderung ergänzt haben. |
Nützliche Planungshilfen: neue dena-Publikationen zu Nichtwohngebäuden und zum Ausbau der Fernwärme
|
|
|
|
Sind sie fit für 2045? Nein, nicht Sie persönlich, sonst wäre das „s“ großgeschrieben: Gemeint sind die öffentlichen Nichtwohngebäude (NWG) in Ihrem Ort. Während die persönliche Fitness weiterhin in die Privatsphäre fällt, greift der Staat in die energetische Fitness von Rathäusern, Schulen oder Behördenbauten zunehmend ein: Das neue Energieeffizienz-Gesetz (EEfG) verpflichtet die öffentliche Hand zu laufenden Energieeinsparungen; ab 2024 soll der Verbrauch jährlich um zwei Prozent sinken. Die neue dena-Studie „Fit für 2045“ zeigt nun erstmalig, wie viel Energie und CO2-Emissionen ein NWG nach energetischer Sanierung noch verbrauchen darf, um als klimaneutral zu gelten. Zentrale Empfehlung der kostenlosen Publikation: Die öffentliche Hand sollte unbedingt das Instrument des Energiespar-Contractings nutzen.
Eine weitere Neuerscheinung der dena bezieht sich auf die Rolle von klimafreundlicher Fernwärme bei der Wärmewende. Aus Sicht der Politik soll sich deren Bedeutung in Versorgungskonzepten bis 2025 nahezu verdoppeln. In einem 18-seitigen „Impulspapier“ hat die dena daher – zeitlich passend zum „Fernwärmegipfel“ im Juni in Berlin – aufgelistet, wo die Herausforderungen und Ansatzpunkte für einen schnellen Ausbau dieser Form der Wärmeversorgung liegen. Für eine zukunftsfähige Fernwärmestrategie gibt es aus Sicht des Autorenteams vier große Stellschrauben, so die Schaffung eines klaren Ordnungsrahmens sowie die Klärung der offenen Fragen bezüglich eines Drittzugangs von Erzeugungsanlagen. |
400 Mio. Euro warten auf passende Förderanträge: neuer Projektaufruf für klimagerechte Sanierung kommunaler Einrichtungen
|
|
|
|
Tropft es bei der Turnhalle durchs Dach? Möchte der Schwimmmeister beim Blick auf das Becken am liebsten untertauchen? Für solche Zustände könnte mit der neuen Förderrunde des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eine Lösung in Reichweite rücken: Kurz vor Redaktionsschluss dieses Newsletters erreichte uns eine Pressemitteilung aus dem Bundesbauministerium, der zufolge 400 Millionen aus dem Klima- und Transformationsfonds für den genannten Förderzweck zur Verfügung stehen. Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden, wobei diese die Zuwendung an Private – was hier in der Regel Vereine meinen wird – weitergeben können.
Vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), das im Auftrag des Bundes als Fördergeber fungiert, können unterstützt werden Sanierungen bei der sozialen Infrastruktur in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, wie Jugendclubs, Begegnungsstätten oder Bibliotheken. Das Ministerium lässt durchblicken, dass Sportstätten und Schwimmhallen die größten Chancen haben. Für alle eingereichten Projekte gelten zwei Anforderungen: Erstens müssen diese eine besondere regionale oder überregionale Bedeutung haben und zweitens eine hohe Qualität im Hinblick auf Energieeffizienz und Klimawandel-Anpassung. Im Prinzip kommt noch eine dritte Voraussetzung hinzu: Die Vorhaben sollten nicht am Anfang der Planung stehen, denn die Bewerbungsfrist läuft nur drei Monate (bis 15.09.). Kommunen, die in dieser Zeit einen Antrag hinbekommen, können auf einen nicht zurückzuzahlenden Zuschuss von bis zu sechs Millionen Euro hoffen. Weitere Informationen zum Projektaufruf finden Interessenten auf der BBSR-Website.
|
Eine Chance für gegenseitiges Lernen und Kooperationen: Deutsch-japanische Bausektor-Studie ist das neue „Projekt des Monats“
|
|
|
|
Tausende Kilometer liegen zwischen Deutschland und Japan. Kein Wunder, dass 2019, im letzten Jahr vor Corona, nur rund eine Viertel Million Bundesbürger das Land der aufgehenden Sonne als Touristen besuchten. In Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit gibt es aber kaum ein interessanteres „Studienobjekt“, denn trotz aller kulturellen Unterschiede bestehen zahlreiche Parallelen – und damit ähnliche Zukunftsaufgaben: Beide Länder sind fast gleich groß, überaltert, technisch hoch entwickelt, stark exportorientiert und wirtschaftlich stark. Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Deutschland die viertgrößte. Da liegt es nahe, die Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors einmal zu vergleichen. Das Öko-Zentrum NRW hat dies gemeinsam mit Partnern getan – unser heutiges Projekt des Monats.
Zusammen mit dem Wuppertal-Institut sowie dem Institut für Energiewirtschaft in Japan wurde in einer vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützten Studie untersucht, wo es Gemeinsamkeiten, Unterschiede und ungenutzte Potenziale gibt. Interessant aus deutscher Perspektive: Trotz jahrzehntelangen Anstrengungen hierzulande gibt es viele Themen, bei denen die Deutschen von den Japanern lernen können: Als Beispiele nennt die Studie den Ansatz zu Energieeffizienz durch HLK-Geräte, Energiemanagementsysteme, vollautomatisierte Häuser und Förderprogramme für den Holzbau. Deutsche Stärken seien vor allem die Fokussierung auf Gesamtenergieeffizienz, bessere Dämmung, Wärmerückgewinnung, Belüftung und erneuerbare Energien. Potenzial für Kooperationen liege unter anderem in der Verknüpfung von deutscher Bauweise mit japanischen Erfahrungen im seriellen Bauen und Fertighausbau, um so kosteneffiziente Sanierungen und kohlenstoffarme Designs zu fördern. Mehr zum Projekt des Monats erfahren Sie hier. |
Tagen im Schatten des Gasometers: gebäudeforum klimaneutral lädt ein zur Netzwerktagung auf dem Berliner EUREF-Gelände
|
|
|
|
Diese Veranstaltung hat Bestand – buchstäblich: Bei der 3. Netzwerktagung des Gebäudeforums klimaneutral geht es um das, was baulich schon vorhanden ist und nicht erst nur in Köpfen von Planenden steckt. Unter dem Leitthema: „Klimaneutraler Gebäudebestand – zukunftsfähig gestalten“ läuft das Fachtreffen am 28. September in Berlin (Beginn: 13:00 Uhr, EUREF-Campus). Die kostenfrei buchbare Tagung richtet sich an Architektinnen und Architekten, TGA-Planende, Energieberatende, Ingenieurinnen und Ingenieure, Verbände, Bildungsinstitutionen und sowie weitere Expertinnen und Experten im Baubereich.
Drei informative Themenpanels warten auf die Teilnehmenden: Es geht um „Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit“, um den „Menschen und die gebaute Umwelt“ sowie um „Klimaschutz-Konzepte im Bestand“. Die hochkarätig besetzten Vortragsteile münden jeweils in eine Diskussionsrunde. Zur Anmeldung für die Tagung des (auch vom Öko-Zentrum NRW mitgetragenen) Netzwerks geht es hier.
|
Die Speicherstraße als Speicherplatz für Graue Energie: Workshop in Dortmund stellt mustergültige Umbauprojekte vor
|
|
|
|
Das Dutzend ist voll: Die Veranstaltungsreihe „Nachhaltige und intelligente Gebäude“ geht am 12. September in die zwölfte Runde – und die widmet sich, so der Untertitel, ganz der „Umbaukultur in der Praxis“. Vorgestellt werden nachahmenswerte Beispiele für die kreative Erhaltung und Umnutzung von Bausubstanz, wie das Hafenquartier Speicherstraße in Dortmund. Denn der Kampf gegen die Erderwärmung zwingt nicht nur zu mehr Nachhaltigkeit im Neubau, sondern auch zum behutsameren Umgang mit Grauer Energie – also der Energie, die in bestehenden Bauwerken bereits enthalten ist und gegenüber einer Neubaulösung eingespart werden kann. Vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie werden in dem Workshop zudem zentrale Fragen zur Bewertung des Bestandsportfolios erörtert.
Seit dem Auftakt 2010 hat sich die vom Öko-Zentrum NRW mitveranstaltete Workshop-Reihe „Nachhaltige und intelligente Gebäude“ zu einem wichtigen Treffpunkt für Investor/inn/en Bauherr/inn/en und alle am zukunftsorientierten Bauen beteiligten Berufsgruppen entwickelt. Ziel ist es, so die Ausrichter, „den Austausch von Ideen und die Initiierung weitergehender Kooperationen zu ermöglichen“. Die Teilnahme am Workshop XII, der erstmals im Baukunstarchiv NRW in Dortmund läuft, ist kostenlos. |
Präsenz an der Alster, Vertiefung am Bildschirm: ZEBAU lädt ein zu „Effiziente Gebäude 2023“
|
|
|
|
Was er von den Auftraggebenden erwartet, daraus macht Hamburgs Architektennachwuchs keinen Hehl: „Baut keinen Scheiß“ lautet das Motto der interaktiven Stadtrundgänge, die Architects4Future zum „Hamburger Architektursommer 2023“ beisteuert. Die Exkursionen sollen Perspektiven eröffnen, wie die Baubranche ihren Ressourcen- und Energieverbrauch mindern kann. Dasselbe Ziel verfolgt auch eine Fachtagung, die am 11. September in der Hansestadt stattfindet – allerdings ist deren Titel weniger drastisch und das Mittel der Wahl ist technisch fundierte Kompetenz.
Die Veranstaltung „Effiziente Gebäude 2023“ des ZEBAU bietet Fachleuten der Baubranche einen Tag lang die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Austausch. Die Tagung – in der auch das Öko-Zentrum NRW mit einem Referat vertreten ist - lässt sich entweder einzeln buchen oder im Paket mit einem zwei Wochen später angesetzten Online-Vertiefungsseminar.
|
Zwei (Bau-)Welterklärer im besten Sinne: Medientipps mit den Professoren Lesch und Hillebrandt
|
|
|
|
Ein Physiker, der im Hier und Jetzt lebt, der kommunizieren und vor allem gut erklären kann – wo gibt’s denn sowas? Im deutschen Fernsehen. Denn dort ist Harald Lesch, seines Zeichens Professor für Astrophysik, mindestens genauso häufig anzutreffen wie in den Hörsälen der Ludwig-Maximilian-Universität München, an der er lehrt. Es macht Spaß, dem Mann zuzuhören, denn der schafft es, auch die komplexesten Dinge spannend erläutern, egal aus welchem Themenfeld die stammen. Das macht ihn zu einem gefragten Moderator und „Wissenschaftsjournalisten“, der, folgt man Wikipedia, schon über 20 Fernsehpreise erhalten hat. Zu den vielen Sujets von Harald Lesch zählt auch das Bauen – genauer: das nachhaltige Bauen.
In einer 30-minütigen Folge der Reihe „Leschs Kosmos“ widmet sich der vielseitige Forscher der Frage, inwieweit „Häuslebauen“ ein Klimakiller ist und was es für massentaugliche Alternativen gäbe. Zu der Sendung bei Youtube geht es hier. „Nur“ rund halb so viele Follower wie Lesch hat auf dieser Videoplattform der Kanal „jung & naiv“ – was aber immer noch 500.000 „Stammkunden“ bedeutet. Der Reihentitel ist reine Koketterie – die hier zu sehenden Interviews sind alles andere als „naiv“. Das belegt auch die Folge 521, ein Gespräch mit Annette Hillebrandt, Architektin und Professorin für Baukonstruktion, Entwurf und Materialkunde an der Uni Wuppertal. Am Ende des zweistündigen (!) Interviews prophezeit – oder befürchtet? – die Expertin für "Circular Economy": „Ich werde der Drosten der Bauwirtschaft …“.
|
Netter Schwarm sucht weitere Intelligenz: Stellenangebote
|
Arbeiten Sie an Ihrer Zukunft. Und an der des Bauens. Bei uns. Das Öko-Zentrum NRW ist einer der führenden Anbieter für Planung, Beratung und Qualifizierung im energieeffizienten und nachhaltigen Bauen. Seit über 30 Jahren stehen wir für die berufsbegleitende Schulung von Bauakteuren, zudem erstellen wir Gutachten und Fachplanungen für Neu- und Bestandsbauten. Interessiert an einem Job mit Sinn und Verstand? Dann lesen Sie unsere Stellenangebote.
Aktuell sind fünf Positionen zu besetzen. |
| TERMINE UND LEHRGANGSSTARTS |
| |
 |
Öko-Zentrum NRW GmbH
Planen Beraten Qualifizieren
Sachsenweg 8
59073 Hamm
Registriergericht: Hamm HRB 1583
Geschäftsführender Gesellschafter:
Diplom-Volkswirt Manfred Rauschen
|
|
|
|
