Liebe Leserinnen und Leser, ein reges Interesse verzeichnet seit Jahren die Sommerumfrage der Fachzeitschrift „Gebäude-Energieberater“. In seiner aktuellen - im kommenden Heft nachzulesenden - Fassung enthält dieses „Stimmungsbarometer der Branche“ sowohl altbekannte Fakten als auch spannende Haltungen zu politischen Themen. So fällt auf, dass es sich bei über der Hälfte der Beratenden um Ingenieurinnen oder Ingenieure handelt. Hingegen ist der Anteil der Quereinsteiger/innen mit knapp vier Prozent immer noch sehr gering. Die Quote von Marktakteuren, die aus dem Feld der Architektur stammen, hat mit nur rund 15 Prozent noch viel Luft nach oben - rückt doch die Umsetzung der Sanierung (Stichwort „Sanierungssprint“) immer mehr in den Fokus. Die Gebäudeenergieberatung hat sich als Beruf über eine lange Zeit hinweg etabliert und so verwundert es nicht, dass weit über die Hälfte der Teilnehmenden bei der Umfrage schon über 15 Jahre „dabei sind“. In dieses Bild passt die Altersstruktur: Zwei Drittel der Antwortenden sind zwischen 50 und 70 Jahren alt. Das entspricht auch der Erfahrung des Öko-Zentrums NRW als großer Weiterbildungsanbieter – nämlich, dass sich viele Menschen noch kurz vor oder nach dem traditionellen Rentenalter entschließen, die (Zusatz-)Ausbildung zu machen, um diesen schönen Beruf ausüben zu können. Bemerkenswert ist die Einschätzung der Befragten zu den letzten Monaten im politischen Berlin. Über ein Drittel äußerte, dass die Zahl der Anfragen von Bauherren drastisch gesunken sei und ein weiteres Drittel sieht zumindest einen leicht gesunkenen Umsatz. Auch bezüglich der Umsatzentwicklung zeigt die Umfrage weit mehr pessimistische Einschätzungen als optimistische. Der Bruch der Ampel hat auch hier deutliche Spuren hinterlassen. Zu diesem Bild passt, was sich die Gebäudeenergieberater (und natürlich nicht nur die) am meisten von der Politik erhoffen: Kontinuität. Neben dem Wunsch nach höheren Fördersummen und der Etablierung des Berufsbildes der Berater sticht der nach verlässlichen und langfristigen Förderprogrammen mit über 88 Prozent der Nennungen klar heraus. Dicht danach folgen die Abschaffung bürokratischer Hürden sowie klare gesetzliche Rahmenbedingungen für Sanierungspflichten. Auf einer Veranstaltung des Öko-Zentrums NRW in der vergangenen Woche hat sich Sabine Poschmann, Staatssekretärin im Bundesbauministerium, klar zugunsten einer entsprechenden Politik geäußert, gleichzeitig aber auch darauf hinwiesen, Teil einer Koalitionsregierung mit unterschiedlichen Sichtweisen zu sein, Das kann man als deutlichen Fingerzeig in Richtung des von Katharina Reiche geführten Bundeswirtschaftsministerium interpretieren. Seien wir also gespannt auf den noch für dieses Jahr angekündigten Entwurf zur Novellierung des GEG. |
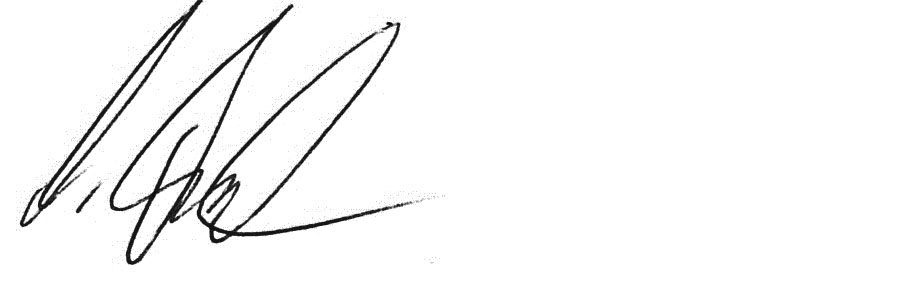 |
Ihr Manfred Rauschen
Geschäftsführender Gesellschafter |
|
| Bundesförderung für effiziente Gebäude: neue technische FAQ, neue Merkblätter, neue Statistiken |
|
|
|
Torschlusspanik angesichts kommender Änderungen? Oder ist das „Produkt“ einfach ein gutes? Das wird sich bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) schlecht aufdröseln lassen. Vielleicht trifft einfach beides zu. Fakt ist jedenfalls, dass BAFA und KfW allein im ersten Quartal dieses Jahres 136.173 Anträge in den drei BEG-Teilprogrammen fördern (Wohn- und Nichtwohngebäude, Einzelmaßnahmen) zählten. Im zweiten Quartal blieb die Nachfrage mit 130.790 nahezu gleich. Jedes in diese Statistiken eingegangene Vorhaben ist ein Schritt in Richtung Klimaschutz. Damit die BEG auch weiterhin „rundläuft“, wurden im August neue technische FAQ (TFAQ) und neue Merkblätter für Effizienzhäuser veröffentlicht. Bei ersteren ging es vor allem um Klarstellungen zur Lebenszyklusanalyse (LCA), zudem um die Einarbeitung von Erläuterungen, die bisher im Infoletter kommuniziert worden waren. Näheres zur aktualisierten TFAQ-Liste (= Version 6.0) steht wie immer in unserer BEG-Übersicht. Das gilt auch für die neuen Merkblätter zu den KfW-Programmen 261 und 263 (= Förderkredit für Wohn- bzw. Nichtwohngebäude). Sie gelten seit dem 1. August und enthalten nur kleinere Änderungen, die sich beispielsweise auf die vorhabenbezogene Unabhängigkeit der Energieeffizienz-Expertinnen/en beziehen. |
| Grundlegende Überarbeitung noch 2025? Berichte über ehrgeizige GEG-Pläne aus dem Wirtschaftsministerium |
|
|
|
Zwischenlösung oder doch gleich großer Wurf? Nach einer Meldung von „Tagesspiegel Background“ rätselt die Baubranche, wie es weitergeht mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die Zeitung, die als gut vernetzt mit dem Berliner Politikgeschehen gilt, hatte Anfang September über angebliche Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums berichtet. Demnach beabsichtige das Ressort von Katherina Reiche, die Überarbeitung des GEG und die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) zusammenzufassen – und das noch in diesem Jahr. Der Bericht überraschte selbst Insider, denn bislang galt es als gesetzt, dass sich das CDU-geführte Haus vorerst mit der Einlösung des Wahlversprechens „Abschaffung des Heizungsgesetzes“ begnügen würde. Bezüglich der EPBD wollte man sich mehr Zeit nehmen: In Brüssel sollte gar eine Fristverlängerung angestrebt werden – so steht es im Koalitionsvertrag. Ob sich Reiche bis Jahresende mit dem (SPD-geführten) Bauministerium einigen kann, darf bezweifelt werden; so oder so ist zu befürchten, dass das Gezerre um das GEG weitergeht. Ungeachtet dessen laufen auch die Bemühungen um die Optimierung des Gesetzes in seiner aktuellen Fassung weiter. Die Projektgruppe Gebäudeenergiegesetz der Bauministerkonferenz hat Mitte August die ersten beiden Auslegungen zum GEG 2024 veröffentlicht, die sich jeweils auf die Gebäudeautomation bei großen Nichtwohngebäuden gemäß § 71a beziehen. Wie immer haben wir unseren GEG-Überblicksartikel entsprechend aktualisiert. |
| Höherer Baukosten-Referenzwert macht KNN-Förderprogramm attraktiver |
|
|
|
Eine gute Nachricht für alle, die bauen wollen, dabei auch das Wohl des Planeten im Blick, aber eine schmale Brieftasche haben, kommunizierte die KfW im Spätsommer via „Multiplikatoren-Rundschreiben“. Gemeint ist damit nicht, dass Küchen und Wohnküchen im Programm „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment - Wohngebäude" (KNN) nun nicht mehr als „Individualräume“ gelten, sondern als „Aufenthaltsräume“ anerkannt werden. Nein, die Rede ist zwar vom selben Förderprogramm, aber von einer Änderung, die gravierender ist und für viele Projekte überhaupt erst eine Nutzung der Förderung ermöglicht: Der Baukosten-Referenzwert im KNN-Programm Klimafreundlicher Neubau wurde deutlich angehoben, nämlich um 18 Prozent. Die Anpassung an die Realität im Bausektor soll dazu führen, dass wieder mehr Bauvorhaben die Förderung erhalten können und gilt rückwirkend auch für bereits erteilte Förderzusagen. Passend zu der Änderung hat die Förderbank eine neue Fassung des KNN-Berechnungstools veröffentlicht (Version 1.04.), das ab sofort für die Planung genutzt werden kann. Der neue Kostenzuschlag liegt 75 Prozent über dem BKI-Baukostenkennwert, also der statistischen ermittelten „Richtschnur“, die das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) regelmäßig veröffentlicht. Mehr Infos zur Neubauförderung „Klimafreundlicher Neubau" (KFN) sowie zum 2024 gestarteten Programm „Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment" (KNN) bietet unser Überblicksartikel – was natürlich auch die erwähnte, ebenfalls rückwirkend geltende Küchen-Änderung inkludiert (durch die sich die maximal zulässige Wohnfläche um 15 qm erhöht). |
| Europäische Gebäuderichtlinie wird konkreter: EU veröffentlicht Dokumente zur Umsetzung in nationales Recht |
|
|
|
„Einszweidrei, im Sauseschritt / läuft die Zeit; wir laufen mit.“ Das berühmte Zitat von Wilhelm Busch, zu finden in seiner Bildergeschichte „Julchen“, hat auch 148 Jahre nach Erscheinen nichts von seiner Aktualität verloren. Es wird gern wendet, um an die Schnelllebigkeit des Alltags zu erinnern – und passt auch gut zur EU-Gebäuderichtlinie. Die „Energy Performance of Buildings Directive“, kurz EPBD, zielt ab auf die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und letztlich darauf, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Auch bei dem zugrundeliegenden Regelwerk läuft die Zeit im Sauseschritt, daher hat die EU jetzt Hilfestellungen für die Mitgliedsstaaten veröffentlicht. Die Novelle der EPBD ist im Mai 2024 in Kraft getreten, mit der Maßgabe, dass die Neuerungen binnen zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden müssen – also in gut acht Monaten. In Deutschland dürfte dies durch über eine Neujustierung des GEG erfolgen. Bei der könnte sich die Bundesregierung an dem Paket von Dokumenten orientieren, das die EU jetzt zur Unterstützung des rechtlichen Integrationsprozesses veröffentlicht hat. Darin geht es beispielsweise um die Methodik für die Berechnung kostenoptimaler Niveaus und um die Übermittlung nationaler Statistiken an die EU, vor allem aber um die Leitlinien für die Neufassung der Richtlinie. Das gesamte Dokumenten-Paket finden Interessierte auf dieser Internetseite(die unser Webadmin mit dem Satz kommentierte „so viele Links waren nie“). Parallel zur EU hat die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) renommierte Institute Überlegungen anstellen lassen zur Umsetzung der EPBD im GEG. Resultat ist ein Gutachten, dessen Schwerpunkt auf der Anforderungssystematik für Neubauten liegt, die die EU-Vorgaben für ein „Zero Emission Building“ erfüllen sollen. In der 300 Seiten starken Publikation geht es aber auch um Analysen zur Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit, um die Einführung der Lebenszyklusanalyse und um Mindesteffizienzstandards für Nichtwohngebäude. |
| Bis zum 30.09. noch schnell beantragen: Förderzusagen für Wärmepumpenschulungen gelten ein Jahr lang |
|
|
|
Ein Förderprogramm läuft aus, das Fördergeld gibt es aber weiterhin – ein Widerspruch? Nicht bei der "Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe": Dieses Instrument, von der vormaligen Ampel-Regierung eingeführt, um der Wärmepumpe zu größerer Verbreitung zu verhelfen, endet am 30. September und soll nicht verlängert werden. Wer jetzt schnell einen Antrag stellt, kann noch von dem „Auslaufmodell“ profitieren, denn „der Bewilligungszeitraum beträgt 12 Monate ab Zugang des Zuwendungsbescheids“, wie es in dem zugehörigen Merkblatt heißt. Das Antragsverfahren kommt Kurzentschlossenen entgegen: Es ist bewusst einfach gehalten und läuft online über das BAFA-Portal. Gefördert werden Qualifizierungen sowie fachpraktische Anleitungen, die auf den effizienten und normgerechten Einbau und Betrieb von Wärmepumpen im Gebäudebestand vorbereiten. Das Programm deckt bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten ab - konkret können bis zu 250 Euro pro Schulungstag und Person für eine anerkannte Schulung geltend gemacht werden. Eine solche finden Interessierte bei der Öko-Zentrum NRW Akademie: Die zweitägige Online-Schulung „Beratung zum Einsatz von Wärmepumpen im Bestand“ vermittelt die technischen Grundlagen und ein tiefergehendes Verständnis zum Einsatz der Anlagen, beleuchtet auch relevante Nebenaspekte wie Finanzierung, Rechtsgrundlagen und Einsatzgrenzen. Nächster Termin ist der 02./03.12.2025. |
| Auch jenseits der Konnexität ein „Betätigungsfeld mit großem Potenzial“: Fachaufsatz umreißt Marktchancen der Wärmeplanung |
|
|
|
Schon einmal von „Konnexitätszahlungen“ gehört? Falls nicht, dürften Sie weder in einer kommunalen Verwaltung arbeiten noch in der eines Bundeslandes. Der Begriff meint einen finanziellen Ausgleich, den Städte und Gemeinden für neue Aufgaben erhalten, die ihnen höhere Verwaltungsebenen übertragen. Warum wir dieses Prinzip hier erläutern? Weil denjenigen, die in der Energieberatung tätig sind oder künftig sein wollen, hieraus wirtschaftliche Chancen erwachsen: Rund 500 Mio. Euro stellt der Bund den Kommunen bis 2028 als Konnexitätszahlungen zur Verfügung, damit die mit dem Geld eine lokale Wärmeplanung erstellen – oder erstellen lassen. Denn laut einer Umfrage des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) beauftragen vor allem kleine und mittlere Kommunen die verpflichtenden Grundlagenpapiere fast ausschließlich extern. „Betätigungsfeld mit großem Potenzial“ lautet daher die passende Überschrift für einen Fachaufsatz, den Jan Karwatzki vom Öko-Zentrum NRW für den „Gebäudeenergieberater“ verfasst hat. Der Gentner-Verlag stellt die Publikation der Leserschaft dieses Newsletters freundlicherweise als Gratis-Download zur Verfügung. Der Artikel stellt kurz die rechtliche Grundlage vor - das Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes -, um sich dann ausführlich dem damit entstandenen Markt zu widmen. Alle rund 10.700 deutschen Kommunen müssen bis (spätestens) 30.06.2028 Wärmepläne vorweisen können. Für die können Energieberatende laut KWW beispielsweise bei Kleingemeinden fünf bis sechs Euro je Einwohner ansetzen. Die kommunale Wärmewende sei kein „vorübergehender Trend“, macht Karwatzki deutlich, sondern „ein gesetzlich verankerter, langfristiger Prozess“ mit ebenso langfristigem Marktpotenzial. Für dessen Nutzung hält die Öko-Zentrum NRW Akademie mit „Wärmewende in der Praxis“ einen Lehrgang bereit, der in inzwischen drei Bundesländern sogar förderfähig ist (NRW, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und am 28. Oktober wieder startet. Info-Veranstaltungen zu dem multimedialen Lernformat laufen vorab am 2.10. und am 6.10.. |
| Aus neun mach eine: Energiekonzept für die Graf-Bernhard-Realschule in Lippstadt ist das neue Projekt des Monats |
|
|
|
Das auf halber Strecke zwischen Dortmund und Paderborn gelegene Lippstadt war schon immer eine Kommune, die „einen Plan hatte“: Im Jahr 1185 wurde sie nach festen Vorgaben beidseitig der Lippe gegründet, Historiker sprechen hier von einer „Planstadt“. Acht Jahrhunderte später hat Lippstadt wieder einen Plan: Bis 2040 soll Klimaneutralität erreicht werden – ein Vorhaben, das unter anderem die energetische Optimierung der kommunalen Gebäude erfordert. Das ist der Rahmen, in dem sich unser neues „Projekt des Monats“ bewegt – die Erarbeitung eines Energiekonzepts für die Graf-Bernhard-Realschule. Die zentrale Herausforderung bei der im Stadtteil Lipperode gelegenen Ausbildungsstätte: Diese ist im wahrsten Sinne des Wortes „historisch gewachsen“. Der älteste Gebäudeteil stammt aus dem Jahr 1953; er wurde mehrfach - zuletzt 1995 - mit Anbauten erweitert. Ab dieser Zeit erfolgten mit dem Austausch von Fenstern und Dämmungen auch die ersten energetischen Verbesserungen. Was bis heute fehlt, ist aber der „große Wurf“. Für den skizzierten die Energieberater des Öko-Zentrums NRW nach aufwändiger Bestandsaufnahme und Analyse der Realschule neun Sanierungsvarianten, die alle gemeinsame Nenner haben: Sie entsprechen zum einen den ökologischen Zielen der Stadt und sind dabei zugleich wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig. Die Empfehlung des Öko-Zentrums NRW besteht in einem Maßnahmenpaket, das bauliche Optimierungen mit solchen der Anlagentechnik kombiniert und den Endenergieverbrauch um fast 70 Prozent reduzieren würde. Zusätzlicher Vorteil dieser Variante, über die Sie hier mehr erfahren, ist die Förderfähigkeit im Rahmen der BEG. |
| Empfehlungen aus der Praxis: BBSR veröffentlicht Ergebnisse des Stakeholder-Dialogs zur kommunalen Wärmeplanung |
|
|
|
Lassen sich die Ergebnisse von vier großen Veranstaltungen zu einem Mammutprojekt der Energiewende plus die unterschiedlichen Blickwinkel der Betroffenen auf wenigen Seiten zusammenfassen? Ja, das geht – das belegt eine neue Publikation des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Das Ergebnispapier „Stakeholder-Dialog Wärmeplanung“ umfasst nur 30 Seiten; für die „Kernbotschaften“ reichen den Herausgebern sogar zwei – was die vielbeschäftigte Zielgruppe in Stadtplanung und Bausektor dankbar aufnehmen wird. Der Hintergrund der Neuerscheinung: Anfang 2024 erfolgte mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) eine wichtige Weichenstellung zur Weiterentwicklung der Wärmeversorgung in Richtung Klimaneutralität. Begleitet wurde das neue Regelwerk durch einen Dialogprozess mit den Beteiligten und Betroffenen, neudeutsch „Stakeholder“ genannt. Auf Betreiben der beiden zuständigen Bundesministerien wurden Kommunen, Länder, Verbände und weitere Fachleute eingeladen, in einem Auftakttreffen und drei Workshops ihre Sichtweisen und Wünsche einzubringen. Den von der dena moderierten Dialog hat das Autorenteam des Ergebnisberichts zu sechs Empfehlungen komprimiert. So plädieren die Beteiligten für eine gezielte Unterstützung kleiner Kommunen, für eine Förderung von Genossenschaften beim Aufbau kleiner Wärmenetze sowie für den Einsatz von Quartierlösungen, wo diese sinnvoll sind. Den in seiner Schriftenreihe erschienen Bericht stellt das BBSR als kostenlosen Download zur Verfügung. |
| Neustart des KfW-Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“: Online-Seminar gibt Tipps zur Antragstellung |
|
|
|
„Der Bund hat beschlossen, 2024 keine weiteren Mittel für das Programm ‚Energetische Stadtsanierung‘ im Bundeshaushalt zur Verfügung zu stellen. Auch für die Folgejahre sind bislang keine Mittel vorgesehen. Damit können (…) keine Anträge gestellt werden.“ So profan liest sich auf der Website der KfW das Ende eines Erfolgsmodells. Von der Einführung des KfW-Programms 432 „Energetische Stadtsanierung“ im Jahr 2011 bis zum Frühjahr 2021 bewilligte die Förderbank über 1.550 Anträge für energetische Quartierskonzepte, dazu kamen weitere 431 Zusagen für ein Sanierungsmanagement. Jetzt gibt es aber Hoffnungen auf eine Reaktivierung des 2023 ausgelaufenen Programms: Voraussichtlich ab Oktober soll wieder Geld in dem Topf sein – der aber erfahrungsgemäß schnell ausgeschöpft sein dürfte. Interessierte Kommunen sollten sich daher alsbald ins Thema einarbeiten – dafür eignet sich gut ein kostenloses Online-Seminar, das B.A.U.M. Consult, KEEA und Öko-Zentrum NRW gemeinsam anbieten. Sandra Giglmaier und Matthias Wangelin informieren in der kompakt gehaltenen Zoom-Konferenz über die geplante Wiederaufnahme der Förderung, geben Tipps zur Herangehensweise bei einer Antragstellung und präsentieren Best-Practice-Beispiele. Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, läuft das Seminar identisch an zwei Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten (am 13.10. um 10.00 Uhr und am 14.10 um 13.00 Uhr). |
| Mehr PV-Anlagen auf mehr Mehrfamilienhäusern: Fachtagung in Hamm will „Mut zum Machen“ vermitteln |
|
|
|
Das Gebäude entscheidet, für wen die Sonne lacht: Die eine Gruppe hat immer häufiger große Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach, der anderen bleibt oft nur das „Balkon-Kraftwerk“, um die Stromrechnung ein wenig zu senken. Die Erstgenannten wohnen in der Regel im Eigenheim, letztere meist in einem Mehrfamilienhaus. Das ist nicht nur nachteilig für die Einzelnen, sondern auch für die Umwelt: Wie das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ausgerechnet hat, schlummert auf den rund 3,3 Mio. Mehrfamilienhäusern ein Potenzial für die Stromerzeugung von 82,5 Terrawattstunden. Eine Veranstaltung in Hamm am 7. Oktober soll dazu beitragen, dass der Dornröschenschlaf endet – indem sie „Mut zum Machen“ vermittelt. Für die ganztägige Tagung „Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern“ hat sich ein Veranstalter-Duo zusammengetan, das sich gut ergänzt: die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie als bundesweiter Fachverband und das Institut für Sektorenkopplung in der Energiewende der Hochschule Hamm-Lippstadt. Letzteres widmet sich der Nutzung des eigenen PV-Stroms auch für Heiz- und Mobilitätszwecke – die die Attraktivität der Energieerzeugung durch PV weiter steigert. Der erste Teil des Programms befasst sich mit der Grundlagenvermittlung, danach geht es weiter mit Modellen der praktischen Umsetzung sowie Best-Practise-Beispielen. Teilnehmen können alle am Thema Interessierten, spezielles Vorwissen ist nicht notwendig. |
| Lernen vom Nachbarn: Delegationsreise zeigt Stand des Nachhaltigen Bauens in den Niederlanden |
|
|
|
Ein Stadtplaner aus Utrecht wird befragt nach seinen Eindrücken bei einer Studienfahrt nach Münster. Ach, in Sachen Verkehrswende habe die Delegation in der deutschen „Fahrradhauptstadt“ nichts mehr lernen können, zuckt der Mann mit den Schultern. „In den Niederlanden sind wir weiter“. Diese Szene aus einer TV-Doku ist symptomatisch für den Trend: Das Ausland schläft nicht – und das gilt auch für „anderes“ Bauen. Mit einer Delegationsreise bietet Greentech.Ruhr die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen vom Sachstand beim westlichen Nachbarn: Die Exkursion „Gebäude der Zukunft – klimaadaptiv und nachhaltig“ führt die Teilnehmenden am 12. und 13. November auch nach Utrecht, dazu in drei weitere Städte. „Wir besuchen inspirierende Bauprojekte und werden Vorreiter der Branche treffen“, verspricht Projektleiter Matthew Graydon von Greentech.Ruhr. Für die Delegationsreise hat sich dieses Netzwerk von Akteuren der Umweltwirtschaft in der Metropole Ruhr mit der Deutsch-Niederländischen Handelskammer zusammengetan. Ergebnis der Kooperation ist ein Programm, das Best-Practice-Projekte und deren Macher/innen in den Mittelpunkt stellt. So lernt die Delegation in Utecht das neuentwickelte Quartier Cartesiusviertel kennen und in Arnheim den energetisch sanierten Industriepark Kleefse Waard. Die Reise richtet sich an Akteure der Bauwirtschaft, Hersteller von Baumaterialien, kommunale Baudezernate und Forschungseinrichtungen. |
| Speed Networking unterm Stadiondach: BAUM lädt ein zur Diskussion über eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft |
|
|
|
Ein gesunder Baum zeigt in jedem Frühjahr neue Triebe. Auch ein gesunder BAUM fällt im Jahrestakt durch besondere Vitalität auf, allerdings erstreckt die sich beim „Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management“, wie das Unternehmensnetzwerk mit vollem Titel heißt, auf den Spätherbst. Dann nämlich lädt der Verband zu seiner Jahrestagung ein. Unter dem Motto „Welche Wirtschaft wollen wir?“ geht es diesmal um „Zukunftsbilder für nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft“. Am 11. und 12. November können Interessierte in Dortmund in Workshops wertvolle Kontakte knüpfen und sich über nachhaltige Lösungsansätze austauschen. Punkten kann die zweitägige Tagung bereits mit dem Tagungsort: Als solchen wählte BAUM e.V. den Signal Iduna Park aus, Heimat des Bundesligisten Borussia Dortmund. Dessen Geschäftsführer Carsten Cramer wurde nicht zufällig auch als Eröffnungsredner eingeladen: Der Verein ist seit Jahren sehr aktiv in Sachen Nachhaltigkeit, so hat er gerade mit Partnern den Bau der weltweit größten PV-Anlage auf einem Stadiondach vereinbart. Wer mit Gelb-Schwarz eher fremdelt, kann sich mit dem abwechslungsreichen Tagungsprogramm ablenken. Zu dem gehört unter anderem ein von Partnerbörsen inspiriertes „Speed Networking“, das das schnelle und unkomplizierte Vernetzen mit Gleichgesinnten fördert. |
| Auf der Suche nach dem Charme der Nachhaltigkeit: Architektur-Bildband ergänzt die Media-Theke |
|
|
|
Thomas Drexel ist Fotograf. Das merkt man dem Buch sofort an, das wir Ihnen heute ans Herz legen, denn es handelt sich um einen Bildband. Nach all den informationsgespickten Sachbüchern und TV-Dokus, die wir in dieser Rubrik schon vorgestellt haben, war es mal an der Zeit für etwas Anderes. Und jenseits der Norm ist es tatsächlich, was Drexel zum Inhalt seiner Publikation gemacht hat. Der Titel ist Programm, es geht um „Nachhaltige Häuser“ – genauer gesagt: um 25 Vertreter dieser immer noch seltenen Gattung. Der Augsburger ist quer durch Deutschland gereist, um interessante Gebäude zu finden, solche, die wie es im Untertitel heißt, „energieeffizient, ökologisch, zukunftsfähig“ sind, dabei aber auch architektonisch ihren Reiz haben. Das Spektrum reicht vom modernen Passivhaus und dem besonders ambitionierten Plusenergiehaus bis zum mustergültig sanierten, energetisch optimierten Altbau. Drexels beruflicher Hintergrund spiegelt sich wider in der Illustrierung der 192 Buchseiten: 220 Fotos nehmen die Leserinnen und Leser mit auf eine gestalterische wie technische Entdeckungsreise. Da der Autor auch lange in einem Architekturbüro gearbeitet hat, kommen zu den Bildern noch 60 Grundrisse. „Das ist das Schöne an diesem Buch“, befand die Süddeutsche Zeitung: „Man kann entspannt darin blättern und sich an den tollen Gebäuden erfreuen, findet aber gleichzeitig auch fundierte Informationen zur Nutzung der Solarenergie oder zu effizienten Heizungssystemen.“ „Nachhaltige Häuser“ erschien 2024 im Prexel-Verlag, kostet 38 Euro und ist überall dort zu haben, wo Bücher zu haben sind. |
Netter Schwarm sucht weitere Intelligenz: Stellenangebote
|
| Arbeiten Sie an Ihrer Zukunft. Und an der des Bauens. Bei uns. Das Öko-Zentrum NRW ist einer der führenden Anbieter für Planung, Beratung und Qualifizierung im energieeffizienten und nachhaltigen Bauen. Seit über 30 Jahren stehen wir für die berufsbegleitende Schulung von Bauakteuren, zudem erstellen wir Gutachten und Fachplanungen für Neu- und Bestandsbauten. Interessiert an einem Job mit Sinn und Verstand? Dann lesen Sie unsere Stellenangebote. Aktuell sind vier Positionen zu besetzen; zudem können Werkstudierende bei uns Praxiserfahrungen sammeln. Gern können Sie sich auch initiativ bewerben. |
TERMINE UND LEHRGANGSSTARTS |
| Erweitern Sie Ihre Kompetenz und damit Ihren Kundenkreis. Auf der Internetseite der Öko-Zentrum Akademie finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Fernlehrgänge und Online-Seminare. |
Eine Auswahl aus dem aktuellen Angebot
|
| FERNLEHRGANGEnergieberater werden in 5 Monaten. Selbstbestimmtes Lernen - wo und wann Sie wollen. |
| | | FERNLEHRGANGEnergieberater werden in 6 Monaten. Selbstbestimmtes Lernen - wo und wann Sie wollen. |
|
|
ONLINE-SEMINAR
Wärmeschutz, Behaglichkeit, Tageslicht |
| | ONLINE-SEMINAR
LCA und ihre praktische Anwendung |
|
|
| ONLINE-SCHULUNGNoch bis zum 30.09. Förderung sichern! BAW Schulung 5 in Kooperation mit der Heat Pump Academy |
| | LEHRGANGKommunale Wärmemanagerin / Kommunaler Wärmemanager werden. Gestalten Sie die Wärmewende.
|
|
|
Save the date! 24. April 2026 |
TAGUNG Herausforderungen und Lösungsansätze rund um den kommunalen Klimaschutz mit dem Schwerpunkt des kommunalen Bauens und Sanierens.
|
|
Öko-Zentrum NRW GmbH
Planen Beraten Qualifizieren
Sachsenweg 8
59073 Hamm
Registriergericht: Hamm HRB 1583
Geschäftsführender Gesellschafter:
Diplom-Volkswirt Manfred Rauschen |
|
|
|
